Jag mich, aber plag dich!
Tiere
In Österreich gibt es verschiedene Tiere, die bejagt werden. Damit Ökosysteme in Balance gehalten werden oder Populationen gesund leben können. Ganz so einfach ist das aber nicht. Denn im Match Mensch gegen Tier hat sich jedes von ihnen einen ganz speziellen Spielzug angeeignet, um nicht getroffen zu werden. Wir haben uns ihre Taktiken genau angesehen und sie auf ein Spielfeld übersetzt.

Drauf Gepfiffen
Das Alpenmurmeltier
Eine der ungeschriebenen Regeln für jedes Spiel lautet: Einen muss es geben, der schaut, dass nicht jeder macht, was er möchte. Das Alpenmurmeltier ist im weitesten Sinne so ein guter Schiedsrichter – zumindest für Spieler seiner Art. In seiner natürlichen Umgebung ist es die meiste Zeit kaum zu sehen und es hält sich immer in der Nähe des Mittelkreises auf, also rund um seinen Bau. Von hier aus hat es nicht nur eine gute Übersicht über das gesamte Feld, sondern auch für alle, die ihm unangenehm auffallen, ein klares und grelles Zeichen: Wenn es etwas entdeckt, was ihm nicht gefällt (ein wütender Fan aus der Luft, zum Beispiel, oder jemand mit einem scharfen Schuss), beginnt es lange und laut zu pfeifen. Die anderen Murmeltiere werden so zurück in die Kabine, also in ihren Bau, beordert und in Sicherheit gescheucht. Pfeift es mehrmals kurz hintereinander, heißt das, es bahnt sich potenzielle Gefahr an. Ein Weckruf sozusagen, um sich wieder auf das Spiel zu konzentrieren.


Von Null auf Hirsch
Der Rothirsch
Es gibt Außendecker, über die erzählt wird, sie wären in ihrem Leben noch keine Kurve gelaufen. Trainer würden sich auf dieser Position auf jeden Fall den Rothirsch wünschen: Groß, robust, gerade Wirbelsäule – perfekter Läufertypus. Ausdauernd und schnell. Und das ist er tatsächlich, vor allem dann, wenn ihn etwas beunruhigt. Dann erinnert sein Spiel ein bisschen an das der Engländer, bevor sie mitbekamen, dass man auch hin und wieder einen Pass spielen kann. Der Rothirsch geht mit Kick & Rush. Oder besser gesagt – nur mit Rush. Bekommt er mit, zum Beispiel dank seines feinen Geruchssinns, dass jemand hier ist, der nicht nur aufs Toreschießen aus ist, startet er los. Mit hohem Tempo zieht er weg und versucht, sich einen Vorsprung herauszuholen. Erst dann schaut er wieder zurück. Und falls da noch ein Gegner steht, wird er es merken. Er ist nämlich das, was im Fußball ein beidbeiniger Kicker wäre – er ist, wenn man so will, beidsinnig. Mit einer tollen Nase und brillanten Augen.
Riecht nach Gefahr
Das Reh
Es gibt ein Motto, das hört man in der Wirtschaft ganz oft, aber eben nicht nur dort: Auch auf dem Sportplatz erzählt man sich, dass man einen guten Riecher braucht, wenn man wirklich gewinnen will. Filippo Inzaghi hatte ihn, der italienische Superstürmer, der gar nicht so ein begnadeter Kicker war, aber eben immer dort stand, wo ein Stürmer stehen sollte. Ähnliches konnte man auch von Hans Krankl sagen. Und natürlich gibt es so jemanden auch im Wald – und zwar das Reh. Das Reh legt es grundsätzlich defensiv an, es überlegt sich genau, an welcher Stelle es besser nicht stehen sollte, und stellt sich einfach woanders hin. Besser gesagt: Es erschnüffelt das Spielgeschehen. 320 Millionen Riechzellen in der Nase (das sind 100 Millionen mehr als ein Hund) sorgen dafür, dass das Reh jeden Gegner schon riecht, selbst dann, wenn der noch gar nicht richtig da ist. Das Einzige, was es dafür braucht, ist Wind aus der richtigen Richtung. Der Spielzug, auf den es dann setzt, sind schnelle Sprünge an den Spielfeldrand ins dunkle Gebüsch. Das Reh sieht nämlich nicht so gut – und in der dunklen Botanik fühlt es sich sicher und unsichtbar.
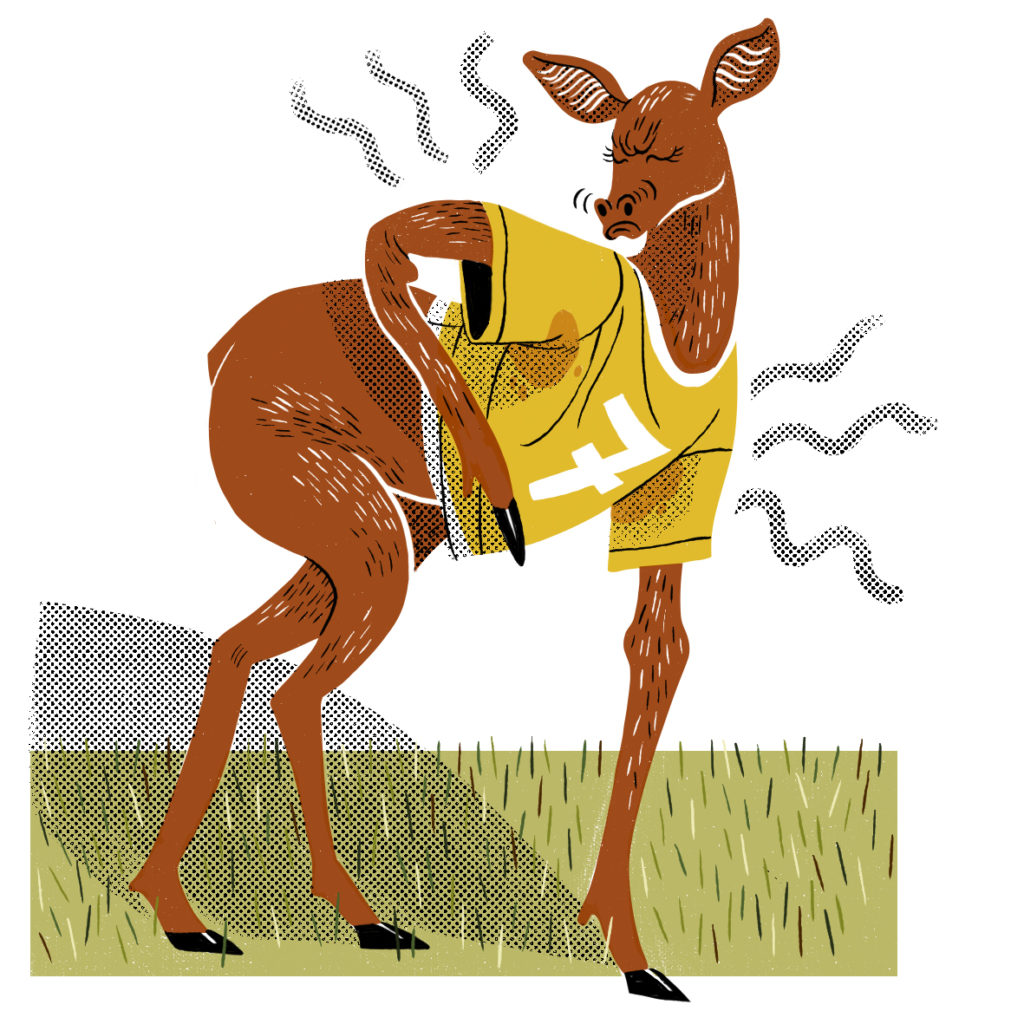

Ich seh, ich seh, was du nie siehst
Die Waldschnepfe
Wenn man darüber nachdenkt, dass es moderne Verteidiger gibt und plötzlich auch Vorstopper, die mehr draufhaben als harte Schienbeine, hat die Waldschnepfe auch mehr als nur ein gutes Auge. Im Wald-Stadion könnte sie alles gleichzeitig sein: Linienrichterin, Video-Assistent-Referee und sogar Überwachungskamera. Dabei schafft sie es sogar, trotz ihrer unscheinbar braunen Federn, eine lässige Attitüde zu behalten, die man sonst nur von Brasilianern kennt: Sie ist ein richtiger No-Look-Spieler. Um alles überblicken zu können, muss sie nämlich nicht einmal ihren Kopf bewegen, jedes ihrer Augen, die seitlich am Kopf sitzen, überblickt einen Winkel von 170 Grad. Also eigentlich fast alles. Egal, ob vorne, hinten, links oder rechts, selbst wenn vor ihr jemand zusammenläuft und hinten ein besoffener Fan mit Bechern wirft, die Schnepfe hat das alles auf dem Radar. Bemerkt sie die Gefahr, ist sie sowieso kaum noch zu treffen. Dann setzt sie nämlich zum Zick-Zack-Flug an. Und der hat in der Flucht eine mindestens genauso hohe Erfolgsquote wie der Haken von Arjen Robben damals bei den Bayern.
Zicke-Zacke-Zicke-Zacke
Der Feldhase
Die besten Stürmer sind die, die lange unscheinbar bleiben und dann plötzlich auftauchen. Roy Makaay war so einer oder Christian Mayrleb, den sah man wenn, dann nur wegen seines roten Kopfes. Der Feldhase spielt in dieser Liga. Selbst wenn er unter Druck kommt, wenn es langsam wirklich eng wird, verharrt er in geduckter Stellung. Er macht sich ganz klein, legt die Ohren an und baut darauf, dass ihn im höheren Gras jetzt niemand mitbekommt. Man könnte sagen, er spart sich die Energie für die wirklich heiklen Momente auf. Und heikel wird es in seiner Wahrnehmung erst, wenn ihm seine Gegner sehr, sehr nahe kommen. Dann aber lautet seine Taktik: Überraschen! Verwirren! Verschwinden! Er springt in die Höhe, nimmt Geschwindigkeit auf (bis zu 70 km/h!) und löst sich mit wilden, fast wahllos aussehenden Zick-Zack-Bewegungen von seinem Gegenspieler. Die Verwirrungstaktik geht meistens auf. Weil irgendwann weiß niemand mehr, wo er eigentlich hinwollte. Wahrscheinlich nicht einmal mehr er selbst. Außer natürlich schnell weg.


Nah an der Bar
Das Wildschwein
Irgendwo, weit unten im Lebenslauf des Wildschweins, könnte unter Hobbys stehen: Sport, aber passiv. Nein, Wildschweine sind nicht faul, aber wenn es um das Spiel im Wald-Stadion geht, sind sie schlau genug, sich nicht direkt in die Schussbahn zu stellen. Warum auch? Sie haben gelernt, dass es draußen auf der Tribüne sicherer ist: Es kommt nichts angeflogen, weder ein Ball noch andere Kugeln, und außerdem gibt es dort auch ganz gute Snacks. Überhaupt taktieren Wildschweine damit, dass ihre Geselligkeit sie schützt. Irgendwann haben sie mitbekommen, dass sie dort, wo viele Menschen leben, nicht viel zu befürchten haben. Weil: Wer schießt auch schon in eine Menge, außer beim Freistoß in die Mauer? Deswegen wären sie wahrscheinlich die Ersten, die nach dem Spiel noch auf ein Getränk in die Stadt mitgehen. Einerseits fühlen sie sich immer wohler, wenn es abends dunkler wird. Und andererseits: Sicher ist sicher.
Taktisches Geplänkel
Von außen betrachtet sieht es manchmal so einfach aus: hinsetzen, warten, schießen. Während im Film jedem Jäger, jeder Jägerin, der oder die auf dem Hochsitz wartet, nach kurzer Zeit Wild scheinbar bereitwillig vor das Gewehr läuft, ist die Realität komplizierter. Weil was, wenn plötzlich der Wind dreht, der Geruch des Menschen rüberzieht? „Das kann es für uns an diesem Tag dann schon gewesen sein“, sagt Fritz Völk. Er ist selbst Jäger, leitet bei den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) dieses Geschäftsfeld. Das Wild, sagt er, sei schlau, sehr schlau sogar.
Aber warum werden Tiere in Österreich überhaupt bejagt? Wieso ist es wichtig, sich zu überlegen, wie viele Tiere in bestimmten Gebieten vorkommen sollen – und vor allem auch welche? „Jagdplanung bedeutet vor allem, Tiere zu entnehmen, von denen es zu viele gibt“, erklärt Völk. Das helfe, Populationen gesund und Ökosysteme in Balance zu halten. Gleichzeitig aber auch, Lebensräume für jene Wildarten zu erhalten und zu verbessern, die unter dem Lebensraumschwund leiden. Dazu gehören übrigens auch Schnepfe und Feldhase. Diese können auch nur dort noch in geringem Ausmaß bejagt werden, wo die Lebensräume für ihre Bedürfnisse ausreichend sind.
Aber jetzt noch mal zurück: Tiere, sagt Völk, sind nicht nur sehr gescheit, sondern auch gut ausgestattet. Mit einem hervorragenden Geruchssinn, zum Beispiel, oder einem guten Gehör, nicht selten aber vor allem auch mit sehr viel Erfahrung – weitergegeben von Generation zu Generation. Sich einfach hinstellen und abdrücken, das, sagt Völk, sei in der Jagd viel zu kurz gegriffen. Ein guter Jäger müsse, um erfolgreich zu sein, sich ins Wildtier hineinversetzen können. „Nur wenn ich weiß, wie es tickt, kann ich es überlisten“, so der Experte.
Umgekehrt versuchen die Tiere natürlich alles, um nicht getroffen zu werden. „Essen, kämpfen, überleben, vermehren – das ist die Basis bei uns allen“, sagt Claudia Kubista, Biologin der ÖBf. Rundherum würden alle natürlich versuchen, ihr Leben schön zu machen. Aber Selbstschutz sei etwas ganz Wesentliches, vor allem, wenn es darum geht, die Nachkommen weiterzubringen. Dabei haben sich die Tiere über die Zeit Taktiken angeeignet, die den Jäger:innen einiges abverlangen: Perfektes Zusammenspiel in der Gruppe, Nachtaktivität und natürlich die bereits erwähnten körperlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel die gute Nase, ein riesiges Blickfeld und in weiterer Folge natürlich auch die schnellen Beine.
Die Balance zwischen Wald und Wild zu finden ist für Waldbewirtschafter:innen nicht immer einfach. Prinzipiell gilt: Je größer die Tiere, desto höher ihr Einfluss auf den Lebensraum. „Dort, wo wir es am dringendsten brauchen, dass der Jäger jagt, dort hat er es am schwierigsten“, sagt Völk dazu. Er meint damit schwieriges Gelände, oben im Gebirge, steil und schroff. Vor allem in Schutzwaldbereichen, in denen der Mensch auf intakte Wälder angewiesen ist, müssen junge Bäumchen, die an höher gelegenen Stellen besonders langsam wachsen, so gut es geht durchgebracht werden. An diesen Stellen ist es deshalb wichtig, die Anzahl der großen Pflanzenfresser, also Reh, Hirsch und Gams, zu regulieren. Aber nicht nur das Gelände, sondern die Kombination aus dem und den speziellen Fähigkeiten der Tiere würde die Herausforderung ausmachen: Eine minimale Unachtsamkeit, ein leises Knacken eines Astes, ein unbedachter Mucks kann die Chance auf einen Jagderfolg bei diesen Tieren zunichtemachen. „Das Tier, zum Beispiel ein Hirsch, wird aufmerksam und richtet sich so aus, dass es richtig im Wind steht und riechen kann, ob Gefahr droht“, erklärt Völk.
Die Evolutionstheorie von Darwin, „Survival of the Fittest“, wird nicht selten mit „der Stärkste überlebt“ übersetzt. Laut Claudia Kubista sei das ein Missverständnis: „Was Darwin eigentlich meinte, ist: Der am besten Angepasste überlebt.“ Das würde unterschiedlichste Ebenen wie Lebensräume und Futtersuche betreffen. Aber eben auch, was getan werden muss, um sich vor Feinden zu schützen.
Jäger Völk ist immer wieder begeistert von der Intelligenz und der Lernfähigkeit der Tiere. „Rot- und Schwarzwild sind die größten Herausforderungen“, sagt er. Die Verknüpfung Schuss – Tod des Artgenossen – Mensch wäre sofort da und würde auch nicht mehr vergessen werden. Jeder handwerkliche Fehler würde in Zukunft sofort zur Flucht führen.
Und dann ist alles natürlich nicht so einfach. Weil eben beide intensiv arbeiten: Der eine daran, zu treffen – und der andere, auf keinen Fall getroffen zu werden. Jeder natürlich mit seiner ganz eigenen Taktik.
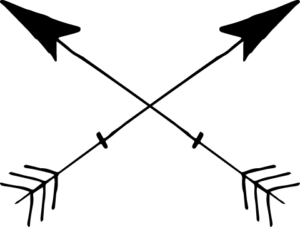
Timo Buchhaus und Christoph Wagner
haben keine Jagderfahrung. Ihre Schießversuche beschränken sich auf Luftdruckgewehre und kleine Zielscheiben im Wiener Prater. Dabei wird es in naher Zukunft wahrscheinlich auch bleiben.