Wissenschaft
Lasst uns reden!
Eine Reihe von Forscher:innen arbeitet gerade daran, die Sprache der Tiere mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu entschlüsseln. Und sie sind sich sicher: Mit etwas Glück könnten wir uns schon bald mit ihnen unterhalten. Bloß: Was würde das für den Menschen bedeuten? Und was für die Tiere?

Der Ort, an dem sich Mensch und Natur näherkommen sollen, sieht so aus, als stehe er kurz vor dem Einsturz. Fronten kippen nach vorne, Fenster schieben sich aus ihrem Rahmen, da sind Fassaden, die sich in zwei Hälften spalten, und andere, die so aufgebläht sind, als würden sie gleich platzen. Von weitem gleicht der von Stararchitekt Frank Gehry entworfene Campus des Massachusetts Institute of Technology (MIT) einem schwankenden, alle Regeln der Statik aushebelnden Chaos. Das ändert sich, sobald man in die Lobby tritt: Drinnen herrscht die Geometrie, Säulen und Stockwerke stehen symmetrisch zueinander, fugenloser Sichtbeton läuft über Treppen und Gänge – bis in das Labor im dritten Stock, Raum 32-368. Dort sitzt Daniela Rus und lauscht jetzt immer öfter den Rufen von Pottwalen. Oder wie sie es nennt: „Ihren Codas.“
Rus ist Informatikerin, sie zählt zu den renommiertesten Robotiker:innen der Welt und leitet das CSAIL, das Forschungslabor für Künstliche Intelligenz und Robotik, am MIT in Cambridge. Hier entstanden die ganz großen Dinge der Gegenwart. Das Internet of Things (IoT), zum Beispiel, dem wir so ziemlich unsere ganze smarte Technik verdanken, wie Handys oder Alexa & Co. Auch das erste fahrerlose Auto wurde auf diesem Campus konzipiert und schon bald soll hier ein weiterer Menschheitstraum in Erfüllung gehen: Das Sprechen mit Tieren.
Als Teil des Teams von CETI (Cetacean Translation Initiative) arbeiten Rus und andere führende Wissenschaftler:innen aus der Linguistik, IT und Biologie gerade daran, die Sprache der Pottwale mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu entschlüsseln. Mit an Bord sind Megasponsoren wie Google und Amazon, was das CETI zwar zum größten, aber längst nicht zum einzigen Projekt macht, das KI auf Tiersprachen ansetzt. Delfine, Bienen, Nacktmulle oder Flughunde sollen, so die Forschenden – auch dank des sprunghaften Fortschritts der Technologie –, bald in der Lage sein, mit uns zu sprechen. Bloß: Haben Tiere überhaupt so etwas wie eine Sprache?
In der westlichen Philosophie galt die Fähigkeit zu sprechen lange Zeit als einzigartig, manche Gelehrte behaupteten sogar, es sei die Sprache, die den Menschen von anderen Spezies abhebe. Der Philosoph René Descartes folgerte aus der Tatsache, dass Tiere nicht sprechen, dass sie auch nicht denken könnten. Nach Immanuel Kant wären sie deshalb „nur als Sache zu gebrauchen“ und Martin Heidegger sprach ihnen gar die Fähigkeit zu sterben ab. Denn: Wer nicht spricht, steht nicht in der Welt und stirbt auch nicht, sondern verschwindet einfach.
Aus der Verhaltensforschung weiß man allerdings inzwischen, dass Tiere sehr wohl imstande sind, Überlegungen mit ihren Artgenossen zu teilen. Präriehunde etwa warnen das Rudel vor Eindringlingen, bei Menschen können sie sogar deren Größe, Kleidung und Haarfarbe beschreiben. Die Sprache von Vögeln, Tintenfischen, Walen und Bienen basiert auf einer Grammatik, die Mantisgarnele in den tropischen Meeren wiederum kommuniziert mit Farben und Delfine sprechen einander sogar mit Namen an. Ja, selbst unterschiedliche Spezies tauschen sich aus: Korallen erkennen den Klang ihres Heimatriffs an der Kakofonie des Ozeans, Ameisen bitten Blattläuse um Honigtau, Hummeln wecken Pflanzen auf und Pflanzen können nicht nur hören, sie teilen Insekten durch elektrostatische Ladung mit, wie viel Nektar sie noch besitzen. Es ist, als hätten sich alle Bewohner:innen eines Ökosystems auf eine Sprache geeinigt. Alle, außer dem Menschen. Weil ein wenig sonderbar ist es schon, dass wir das Verhalten von atomaren Teilchen detailliert beschreiben können, dass es uns gelingt, den Urknall im Labor nachzustellen, nicht aber Tiere, mit denen wir uns seit zigtausend Jahren den Planeten teilen, in ihrer Sprache zu begrüßen. Bis jetzt zumindest. Aber warum soll ausgerechnet nun die Zeit sein, ihnen so nahe zu kommen wie noch nie? In einem Zeitalter, in dem die Angst vor Insekten größer ist als die vor Autos auf einer Schnellstraße, in dem wir – historisch gesehen – noch nie so wenig Zeit draußen verbracht haben und uns stattdessen mit „morning routines“ jeden Tag aufs Neue „grounden“ müssen, bevor wir für den restlichen Tag hinter unseren Bildschirmen verschwinden? Und dann ist es nicht einmal Empathie, die uns dabei helfen soll, sondern – wieder einmal – Maschinen, Algorithmen, Datensätze. Kann das gutgehen?
„Technik ist kein Widerspruch zu unseren Sinnen, sondern eine Erweiterung“, sagt Daniela Rus. Unser Hörvermögen etwa fällt, verglichen mit anderen Spezies, ziemlich bescheiden aus, es beschränkt sich auf einen kleinen Frequenzbereich, der mit zunehmendem Alter immer schmäler wird. Das sei ein wichtiger Teil der Erklärung, warum wir auf diesem Gebiet noch nicht weiter sind. Denn Tiere, die jenseits dieses Bereichs kommunizieren, deren Laute also vom Menschen nicht wahrnehmbar sind, galten der Wissenschaft als sprachlos. Das änderte sich eben erst mit dem Aufkommen digitaler Technologien: Plötzlich erweiterten sensible Aufnahmegeräte unser Hörvermögen und wie durch ein Fenster, das sich im Dunkeln auftat, konnten wir einen Blick auf eine andere, bisher verborgene Lebenswelt werfen. Von Schildkröten, die man bis vor kurzem noch für stumm und taub hielt, wissen wir inzwischen, dass sie ihre Jungen durch niederfrequente Rufe ins Wasser navigieren. Wir haben erkannt, dass der männliche Pfau, der zur Paarung ein Rad schlägt, kräftige Infraschallwellen erzeugt und dass es sich dabei nicht – wie bisher angenommen – um eine visuelle Vorführung handelt, sondern um eine akustische. KI-basierte Sprachmodelle wie das CETI gehen aber noch einen Schritt weiter, man möchte nicht mehr bloß am Fenster stehen, man möchte es öffnen, durchklettern und sagen: „Hallo, hier bin ich.“
„Technologie, die es uns ermöglicht, direkt mit anderen Arten zu kommunizieren, würde eine neue Art des Seins-in-der-Welt vermitteln“, schreibt die Autorin und KI-Expertin K Allado-McDowell in ihrem kürzlich erschienenen Sachbuch „Air Age Blueprint“. Die Idee dahinter: Indem man auch Tieren eine Stimme gibt, könnten neue, gerechtere Formen des Miteinanders entstehen. Auch der Biologe und Gründer des CETI-Projekts David Gruber sieht darin eine Möglichkeit, Tieren zu mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu verhelfen: „Durch Künstliche Intelligenz können wir mehr Empathie und Verständnis zwischen Arten aufbauen.“ Es geht, so Gruber, auch darum, das Wesen der Tiere zu ergründen, immerhin leben wir seit Jahrtausenden nebeneinanderher und wissen so gut wie nichts übereinander. Anstatt die Antennen auf den Weltraum zu richten, könnten wir genauso im Meer eine Kultur erforschen, die uns ähnlich fremd ist. Diese These ist nicht unbedingt neu, schon Jahrzehnte vor der Erfindung des World Wide Webs sagte der Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan eine digitale Revolution voraus, bei der die Vernetzung von IT-Stationen einem planetaren Nervensystem entsprechen würde. Erst die Technologie, so McLuhan, ermöglicht ein harmonisches Zusammenleben zwischen Tier und Mensch.
Nur wenige Forscher:innen des CETI-Projekts haben einen Pottwal schon mal aus der Nähe gesehen. Sie alle kennen aber seine Rufe. Es sind sperrige, kurze Knacklaute, die wie Morsezeichen klingen und so rhythmisch sind, dass selbst Laien glauben, darin gewisse Muster zu erkennen. Aber sind das nun Wörter? Oder sogar Sätze? Um das herauszufinden, analysieren die Expert:innen die Tonaufnahmen mittels maschineller Lernverfahren, einer Klasse von Algorithmen, die eigentlich der Modellierung von menschlicher Sprache dienen. Aus Tonaufzeichnungen gelingt es, mit diesen Programmen die Struktur einer Sprache zu erkennen, ohne dabei irgendetwas über Wörter oder Sätze zu wissen. Solche Sprachmodelle sind „Vervollständigungsmaschinen“. Gibt man ihnen einen Satz vor, spinnen sie ihn Wort für Wort weiter. Weil man damit zwar die Syntax, also den Aufbau einer Sprache, erkennt, nicht aber deren Inhalt, kombiniert Daniela Rus die Sprachaufnahmen mit Daten zum Verhalten der Wale. Welches Tier sagt was? Gab es eine Reaktion? Wo befinden sie sich? „So erhalten wir Hinweise auf die Bedeutung der Lautäußerungen“, sagt sie. Es sei ein vorsichtiges Herantasten, ein langsames Anlernen des Systems. Erste Erfolge konnten die Forscher:innen damit schon verbuchen, so entschlüsselten sie ein Signal, das die Tiere nutzen, um ihren Tauchgang einzuleiten, sozusagen das erste Wort. Gelingt es ihnen, ein umfassendes Wörterbuch zu erstellen, ist ein System denkbar, das die Laute der Pottwale für Menschen übersetzt und wiederum plausible Sätze in ihrer Sprache erzeugt. Ein Google Translate für Pottwalisch, sozusagen.
Aber was hätten uns die Meeresriesen zu sagen? Wo man den schönsten und größten Kalmar findet? Wie wir ihnen helfen können, wenn die Kälber kränkeln? Oder aber fragen sie: Was habt ihr mit uns gemacht? Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, da bewunderte man die Pottwale nicht für ihre Sprache oder ihren Sinn für Gemeinschaft, es war auch nicht die Wissenschaft, die sich für sie interessierte, sondern die Industrie: Ihr Fett wurde zu Schmieröl verarbeitet, ihre Köpfe zu Wachs und ihr Fleisch zu Rinderfutter. Bis in die späten 1970er-Jahre wurden die Tiere so intensiv gejagt, bis nur noch etwa 800.000 übrig blieben – früher gab es mehrere Millionen Pottwale.
Die Philosophin und Tierethikerin Judith Benz-Schwarzburg hält es für unwahrscheinlich, dass Wale den Menschen als Gesprächspartner akzeptieren würden. Und Initiativen wie das CETI würden ihrer Meinung nach ohnehin mehr über das Wesen des Menschen verraten als über das der Tiere. „Die eigentliche Frage ist doch, wieso wir das unbedingt wollen“, sagt sie. Denn hinter dem Bedürfnis, mit Tieren zu sprechen, stehe eigentlich der Wunsch, mit einer Welt in Kontakt zu treten, die uns fremd geworden ist. Mit anderen Worten: Wir suchen nicht bloß die Nähe zu Tieren, sondern zur Natur.
Glaubt man einer Reihe von Wissenschaftler:innen, darunter führenden Köpfen der Geo-, Kultur- und Sozialwissenschaft, befinden wir uns gerade in einem Epochenwechsel. Das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, sei angebrochen und die Beweislage dafür recht eindeutig: Die Atmosphäre ist erhitzt, das Ozon löchrig und der Planet – bis auf drei Prozent – verformt, verschmutzt, verbaut. Und die Frage ist schon auch, mit wem wir in Dialog treten wollen. Tatsächlich mit den Wildtieren in der Natur, den übrig gebliebenen vier Prozent? Oder zählen wir hier auch Nutztiere dazu – die Schweine, Rinder und Hühner? Jene Tiere, die der Mensch vor langer Zeit der Natur entrissen hat und die inzwischen den überwiegenden Teil der Säugetiere ausmachen. „Unsere Vorstellung von Natur ist verklärt, widersprüchlich und blendet erfolgreich aus, wie wir sie zugerichtet haben“, sagt die Tierethikerin Benz-Schwarzburg. Einerseits ist da das romantische Bild von Wildnis, dem ewigen Sehnsuchtsort, andererseits möchte der Mensch die Natur und das Tier beherrschen. Die Idee des Menschen, schrieben schon Adorno und Horkheimer in der „Dialektik der Aufklärung“, drücke sich in der Unterscheidung vom Tier aus: „Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde.“ Eine Perspektive, die sich seit der Antike nicht verändert hat. Blickt der Mensch auf das Tier, schaut er nach unten, auf ein niederes Wesen. Was würde aber nun passieren, wenn ein Mastschwein in Menschensprache ausdrücken könnte, was aus der Verhaltensforschung längst bekannt ist? Nämlich, dass es sehr wohl Schmerz und Leid zu fühlen vermag? „Es wäre ein moralisches Desaster“, sagt Benz-Schwarzburg. „Nicht nur, dass unsere moderne Lebensweise undenkbar wäre ohne die offenen und verdeckten Beiträge von Nutztieren, sie beruht auch auf deren Unsichtbarmachung“, so die Expertin. Wenn es also gelingt, was David Gruber vorhat, wenn die Pottwale nur der Anfang sind und man irgendwann die Sprache aller Tiere mittels Künstlicher Intelligenz entschlüsseln kann, würde uns das der Natur wohl nicht näher bringen. Womöglich würden wir erst dann begreifen, wie weit wir uns von ihr entfernt haben.
Aus der Linguistik weiß man, dass Sprache alles andere als eindeutig ist, und dass sie noch lange kein harmonisches Zusammenleben garantiert, beweist die Menschheit seit Tausenden von Jahren. Auch der Wildtierökologe Robin Sandfort ist der Meinung, dass wir nicht unbedingt als Gesprächspartner für Tiere taugen, trotzdem analysiert auch er Tierstimmen mittels Künstlicher Intelligenz. Im Unterschied zu CETI geht es aber Sandfort nicht darum, mit den Tieren in Kontakt zu treten, vielmehr möchte er sie in Ruhe lassen. Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten konnte er etwa in Tonaufnahmen Brutstätten des vom Aussterben bedrohten Wachtelkönigs durch Künstliche Intelligenz ausmachen. Damit die Vögel ungestört bleiben, wurden Wiesen, in denen sie sich niedergelassen haben, unter Schutz gestellt. Künstliche Intelligenz, so Sandfort, würde ein sensibleres und aufmerksameres Zusammenleben zwischen Mensch und Tier ermöglichen – als Übersetzungstool hält er sie allerdings für unbrauchbar. Denn Tiere hätte einen ganz eigenen Blick auf die Welt.
Wollen wir diesen ergründen, müssen wir vielleicht gar keine Sprache erlernen. Sondern das Zuhören.
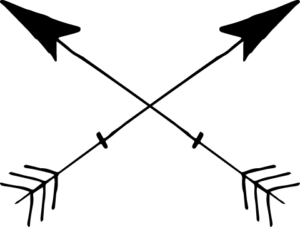
Lisa Edelbacher
fragt sich, was ihr die Taube eigentlich damit sagen will, dass sie sich ihr Fensterbrett als Toilette ausgesucht hat.