Superheldin 972-1
Die Esche stirbt seit Jahrzehnten aus und das liegt an einem Killerpilz, der sich wie ein unbesiegbarer Endgegner verhält. Doch nun gibt es Hoffnung: Ein Forschungsprojekt aus Österreich hat offenbar eine Lösung gefunden, den sinistren Wüterich unschädlich zu machen.

Sie ist die biederste Superheldin der Welt: 972-1, eine Esche, schlanker Stamm, lichte Krone, der dominierende Baum in einer Lichtung voller Jungpflanzen. 972-1 ist nicht besonders hoch und nicht besonders imposant. Ihre Blätter sind nicht grüner, ihre Rinde ist nicht glatter als die anderer Eschen. Trotzdem umschließt sie eine Art VIP-Bereich. Ein mannshoher Wildschutzzaun sichert mitten im Stockerauer Auwald Baum und Jungpflanzen, der Eingang ist mit einem Kettenschloss versperrt – denn 972-1 hat Superkräfte, kein Witz. Sie scheint gegen das Eschen-Stängelbecherchen resistent zu sein. Jenen invasiven Pilz, der seit knapp 30 Jahren Europas Eschenbestände dahinrafft. Um zu verstehen, warum das so sensationell ist, muss man aber erst einmal die Vorgeschichte kennen.

Das Eschen-Stängelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus) ist auch in voller Pracht keine besonders eindrucksvolle Erscheinung. Es sieht aus wie ein winziges Schirmchen, aber um das zu erkennen, muss man schon sehr genau hinschauen, es wird nämlich nur maximal sieben Millimeter groß. Für die Forstwirtschaft, den Naturschutz und das Ökosystem ist die Pilzart aus der Unterabteilung der Echten Schlauchpilze aber eine ausgewachsene Katastrophe. „Dieser Pilz verursacht das gefürchtete Eschentriebsterben“, erklärt Stefan Schörghuber, der Leiter der Stabsstelle Wald-Naturraum-Nachhaltigkeit der Österreichischen Bundesforste. „Zuerst befallen die Sporen die Blätter. Dann dringt die Infektion in die Triebe ein. Sie tötet den Baum in Raten. Nach den Trieben sterben einzelne Kronenteile ab, schlussendlich der ganze Baum.“ Bisher konnte sich die heimische Esche in der Evolution nicht an den eingeschleppten Pilz anpassen, meint Schörghuber.

In Österreich sind die ersten Symptome den Forscher:innen 2005 aufgefallen, etwa zehn Jahre, nachdem der Pilz eingeschleppt worden ist, man vermutet: über Polen und Litauen. Einmal hier angekommen, hatte der Killer mit dem niedlichen Namen leichtes Spiel. Zwei der drei heimischen Eschensorten infizierten sich flächendeckend. Anders als die Mandschurische Esche aus der Heimat des Eschen-Stängelbecherchens hatte die Evolution unsere Gemeine Esche (Verbreitungsgebiet: ganz Österreich, am üppigsten entlang der Donau) und die Quirlesche (am häufigsten in den Marchauen) nicht auf den unbekannten Feind vorbereitet. Die Folgen sind bis heute verheerend. Laut der aktuellsten Österreichischen Waldinventur sank die bundesweite Eschen-Stammzahl zwischen 2009 und 2021 von 105,969 Millionen auf 77,612 Millionen – also um mehr als ein Viertel. Betroffene Bäume fällen, infizierte Pflanzenteile verbrennen? Vergebliche Liebesmüh. Sobald der Pilz Fruchtkörper ausgebildet hat, verbreitet der Wind seine Sporen. Und der weht bekanntlich überall(hin). Ist das leichte Gepäck einmal in der richtigen Luftschicht gelandet, bleibt nicht einmal ein Transkontinentalflug ausgeschlossen. Darum stirbt die Esche überall in Europa – in Deutschland, in Irland, in Skandinavien.
„Das ist aus vielen Gründen ein Drama“, sagt Michael Gruber. Der Leiter der Forstverwaltung Stockerau hat breite Schultern, einen festen Händedruck und viele Sorgen. Er ist Förster in dritter Generation. „Ich hab’ die Verantwortung für den Wald im Blut“, sagt er. „Mir liegt jeder Baum am Herzen, als wäre er mein eigener.“ Darum macht Michael Gruber nicht nur der wirtschaftliche Schaden Kopfschmerzen – die Esche ist nämlich ein wertvolles Edellaubholz, zäh und tragfähig, die beste Wahl für Hammer-, Axt- und Schaufelstiele. Sie ist auch ökologisch von großem Wert. „Diese Baumart könnte ein wichtiger Faktor in der modernen Forstwirtschaft sein. Sie ist vielseitig und anpassungsfähig, eigentlich gut gerüstet für den Klimawandel“, sagt er, „aber das wirtschaftliche Risiko, neue Eschen zu setzen, ist schon seit Jahren viel zu hoch.“

Dabei muss er sich nicht nur mit dem wirtschaftlichen Risiko herumschlagen, sondern auch mit dem unmittelbar physischen. „Schaut’s einmal da“, sagt er und verschwindet in einem Brombeerbusch. Aus den Dornenranken ragt ein stattlicher Altbaum, unauffällig bis auf ein paar Flecken auf den Blättern. Aber einer von Grubers Sorgenkindern: Seine Stammbasis ist völlig morsch, die Wurzeln sind weggefault – typisch für eine geschwächte Esche, die neben dem Eschen-Stängelbecherchen auch noch von einem zweiten Übeltäter besiedelt wurde, dem wurzelbürtigen Fäuleerreger Hallimasch. Michael Gruber hat den zwei Meter daneben verlaufenden Weg abgesperrt. Er fürchtet, dass der Baum spätestens beim nächsten Sturm umstürzen könnte, und will keine Gefahr eingehen. „Anderswo werden Eschen auch vorsorglich ohne Symptome gefällt. Aber wir sind zugleich ein Stadterholungs- und ein Landschaftsschutzgebiet“, sagt er. „Darum bin ich einerseits dem Umweltschutzgedanken verpflichtet. Andererseits aber auch den Spaziergängern und Radfahrern, die sich im Wald frei bewegen wollen.“
Und natürlich dem Berufsethos, seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin einen gesunden Wald zu hinterlassen. „Ich bin der Erste, der die Esche wieder aufforsten will“, sagt er, „aber erst, wenn die Wissenschaft grünes Licht gibt.“




Die Wissenschaft steht neben Michael Gruber unter der morschen Esche und nickt verständnisvoll. Die Wissenschaft, das sind in diesem Fall Gregor Unger und sein Master-Student Florian Palli. Die beiden sind vom Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz der Universität für Bodenkultur Wien. Und sie sind vorsichtig optimistisch.
Unter der Projektleitung des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) und gefördert vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, der Landwirtschaftskammer Österreich, den Landesforstdirektionen aller Bundesländer sowie den Naturschutzabteilungen der Länder Oberösterreich und Salzburg haben die Forscher:innen nämlich in den letzten Jahren ein paar spannende Dinge herausgefunden. Die revolutionärste Erkenntnis: Zwei bis fünf Prozent des heimischen Eschenbestands könnten gegen den Pilz resistent sein. „2015 und 2017 hat das Projekt ,Esche in Not‘ deshalb 715 samentragende Jungbäume in ganz Österreich lokalisiert und ausgewählt, die anscheinend gegenüber dem Pilz tolerant sind“, sagt Gregor Unger. Warum Jungbäume? Weil alte, sehr dicke Eschen oft jahrelang brauchen, bis sie erste Krankheitssymptome zeigen. Jüngere Eschen bilden hingegen innerhalb von zwei, drei Sommern die typischen Alarmzeichen: welkende und nekrotische, also abgestorbene Blätter, von denen der Pilz über die Blattspindel zum Trieb wandert und von hier weg immer größere Teile des Baumes zerstört. 972-1, die eingangs erwähnte, umzäunte Esche im Stockerauer Auwald, könnte diese Superkraft haben. Sie ist eine der 715 abgebrühten Haudegen, die mitten in einem stark befallenen Gebiet wachsen, sich davon aber völlig unbeeindruckt zeigen – obwohl man nur an einer beliebigen Stelle des Waldes in der feuchtwarmen Blattstreu wühlen muss, um auf die kleinen Hütchen an abgefallenen, schwarz gefärbten Eschenblattspindeln zu stoßen, reinweiß die ganz frischen Fruchtkörper, cremefarben die älteren. „Unsere Hoffnung ist, dass sich die Resistenz gut vererbt. Dass wir aus dem Saatgut der resistenten Mutterbäume resistente Tochterpflanzen ziehen können. Und dass wir mit diesen resistenten Pflanzen die Esche als Baumart für die österreichische Forstwirtschaft und den Naturschutz erhalten können.“

Theoretisch könnte man diesen Feldversuch auch der Natur überlassen. Hätten die Wissenschaftler:innen mit ihrer Vermutung recht, könnten sich die resistenten Exemplare schon in drei- oder vierhundert Jahren durchsetzen. Die Wälder wären dann wieder gut durchmischt und die Art gerettet. Vielleicht würde sogar der Eschen-Scheckenfalter so lange durchhalten, ein stark gefährdeter Schmetterling, der seine Eier nur auf Eschenblättern ablegt.
Die Menschen in der Forstwirtschaft sind es gewohnt, in Jahrzehnten zu denken. Jahrhunderte sind dann aber doch ein bisschen sehr, sehr lange – zumal die Esche kein Nischenprodukt ist. Sie ist, bezogen auf die Stammzahl, aktuell die zweithäufigste Laubbaumart im Land. Nur Buchen gibt es in Österreich noch mehr.
Darum wurden aus den 715 Mutterbäumen bis dato 35.000 Nachkommen gezogen. Und aus denen wiederum 1.000 Klone, die auf Samenplantagen im oberösterreichischen Feldkirchen wachsen, im vorarlbergerischen Rankweil und ab Herbst auch in Nikolsdorf in Tirol. Mit den Versuchspflanzen tun die Wissenschaftler:innen alles, um die eigene Theorie infrage zu stellen. Die mutmaßlich resistenten Jungpflanzen werden mit den Artgenossen anfälliger Mütter durchmischt, der Befall wird aufgeteilt in sechs Kategorien von „stark befallen“ bis „kaum befallen“ erhoben. Und wirklich: Die Nachfahren der Pflanzen mit 30, 50 oder 80 Prozent befallenen Pflanzenteilen werden tatsächlich im Schnitt 30, 50 oder 80 Prozent kränker. Und die Abkömmlinge potenziell resistenter Mutterbäume bleiben tendenziell gesund. „Wobei natürlich auch der Vaterbaum eine Rolle spielt, also der Pollenspender. In der Natur gibt es ja immer mehrere unbekannte Bestäuber“, sagt Gregor Unger.

Darum geht es 20 Kilometer südwestlich des Stockerauer Auwalds noch ein bisschen strenger zu. In Tulln hat das BFW einen siebeneinhalb Hektar großen Versuchsgarten angelegt. „Der größte Versuch zum Eschentriebsterben in ganz Europa“, sagt Dr. Heino Konrad, der Abteilungsleiter für Ökologische Genetik am Institut für Waldbiodiversität und Naturschutz. Hier wachsen die 35.000 Versuchseschen, jede einzelne unter permanenter Beobachtung – im Freiland, im Topf und im Gewächshaus –, unbeschwert dem Himmel zu oder künstlich mit Hymenoscyphus- oder Hallimasch-Sporen infiziert. Auch hier führen alle Versuche zum gleichen Ergebnis: Die Resistenz scheint sich zu vererben. Doch die Natur lässt sich nicht so hetzen, wie es uns Menschen lieb wäre: Eine frisch gezogene Esche nimmt sich zehn bis 15 Jahre Zeit, bis sie zum ersten Mal Samen trägt. Darum arbeitet man in Tulln auch mit Stecklingen und Veredelungen wie im Obstgarten. Und beschleunigt so die Vermehrung.
Zuständig dafür ist Franz Henninger. Der Obergärtner des Tullner Freiluftlabors kümmert sich jeden Tag um das Wohlergehen seiner kostbaren Schützlinge. Und nimmt Nuancen wahr, die nicht nur uns Laien entgehen, sondern sogar den Wissenschaftler:innen. „Jede Pflanze hier hat ihre eigene Persönlichkeit“, sagt er. „Jede hat ein anderes Blattgrün, ihre eigene Form der Ausprägung. Es ist fast wie mit Pflegekindern: Man macht sich Sorgen, wenn sie aus der Baumschule hinaus in die Welt müssen. Und man freut sich, wenn sie an einen guten Platz kommen.“

Doch warum eigentlich all die Mühe? Könnte man nicht einfach im Labor ein, zwei Gene pimpen und künstlich eine resistente SuperEsche erschaffen? Heino Konrad gibt sich Mühe, uns nicht gleich vor die Tür zu setzen. „Dreimal Nein“, sagt er. „Erstens, weil es verboten ist. Zweitens, weil wir Arten erhalten und nicht manipulieren wollen. Und drittens, weil das Thema viel komplexer ist: Wir konnten die Gene für die Resistenz noch nicht lokalisieren. Die entscheidenden Faktoren scheinen in hoher Zahl über weite Teile des Genoms verteilt und nicht eng begrenzt zu sein.“ Darum überlässt man die Arbeit lieber der verantwortungsbewusstesten Gentechnikerin, die es am Job-Markt gibt: der Natur. „Wir brauchen Geduld“, sagt Heino Konrad. „Es wäre unseriös, jetzt schon Entwarnung zu geben und die Forstbetriebe mit den Pflanzen zu beliefern, die wir für resistent halten. Aber ja: Es sieht gut aus.“
Dann öffnet er die Tür zum Gewächshaus. Eine Wasserdampfwolke erschlägt uns, 40 Grad heiß und tropisch feucht. Als sich der Nebel legt, erkennt man tausend Jungpflanzen in kleinen Töpfchen – die jüngste Generation von widerstandsfähigen Stecklingen, gerade dabei, Wurzeln zu entwickeln. Wenn alles gut geht, entsteht aus ihnen bald in Oberösterreich, in Vorarlberg oder in der Steiermark ein neuer Wald. Und straft alle Prognosen von der ausgestorbenen Esche Lügen.
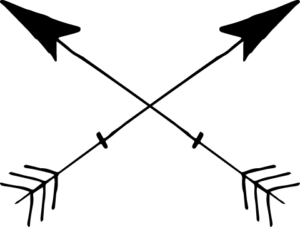
Alexander Lisetz
findet, dass die Welt mehr gute Nachrichten braucht.
Und dass auch die übrigen Weltprobleme tiefenentspannten BOKU-Professor:innen überantwortet werden sollten.