Die drohne als forstfacharbeiter:in
Auch schwer erreichbare Waldgebiete brauchen Aufforstung. In Tirol startete ein Pilotprojekt mit einer 30 Kilogramm schweren Drohne. Sie sät Bäume und Sträucher. Wie geht Forstwirtschaft heute? Wie hilft uns die Technik?

Es ist ziemlich still im Zillergrund, Mayrhofen. Kein Vogel ist zu hören, kein Wind, nur ein Bach rauscht irgendwo in der Ferne, er plätschert ruhig vor sich hin. Es ist idyllisch hier, doch plötzlich wird es laut, ein tiefes Brummen nähert sich, doch es ist nichts zu sehen. Nicht im Wald, nicht auf der Forststraße, auf der sich ein paar Menschen versammelt haben. Was ist das? Plötzlich schiebt sich ein seltsames Gerät über die Bäume. Es sieht aus wie ein fliegender Kühlschrank, der an vier Rotorblättern hängt. Es ist eine ziemlich spezielle Drohne.
Daniel Sachse steht ein Stück weiter den Forstweg hinauf, er ist an diesem Tag der Pilot der Drohne. Er macht das ruhig, mit fast unmerklichen Bewegungen, und obwohl sein Gerät deutlich schwerer und vor allem größer ist als alles, was man so als Laie kaufen kann, steuert er seine Drohne mit einem ganz normalen Controller. In einem dichten Nadelwald so wie hier hat man nämlich nur in den seltensten Fällen direkten Blickkontakt zum Fluggerät. Aber für einen Profi wie Sachse ist das kein Problem. In langen, eleganten Runden fliegt er seine Schleifen durchs Gelände, von der Forststraße hinüber zu einem Gegenhang und dann langsam wieder zurück. Er transportiert dabei Baumsamen, denn Sachse will dabei helfen, schwer zugängliche Flächen im Zillergrund wieder zu bewalden. Mit einer Drohne.
Für die Österreichischen Bundesforste ist dies das erste Pilotprojekt. Aufforstungen finden nach wie vor in traditioneller Handarbeit statt, eine aufwendige und vor allem schweißtreibende Angelegenheit. Nicht nur, dass die Setzlinge, die in Baumschulen gezogen werden, jedes Mal händisch eingesetzt werden müssen: Oft sind die Aufforstungsflächen nicht gut erschlossen, weswegen die Bäume zu Fuß zum jeweiligen Einsatzort getragen werden. Das kostet Zeit, Ressourcen und Geld, sagt Tobias Robisch, der Revierleiter im Forstrevier Hinteres Zillertal. Für die eineinhalb Fußballfelder große Fläche, die heute auf- geforstet werden soll, würde er normalerweise „einen Tag mindestens drei Leute abstellen müssen“. Mit der Drohne dauert das, falls das Gebiet vermessen und kartografiert ist, gerade mal eine Stunde.



Sachse ist wieder einmal von einer Runde zurückgekommen, der Quadrocopter steht jetzt vor ihm und wird neu gefüllt. Das Gerät, das selbst an die 30 Kilo wiegt, hat auf seinem Rücken einen kleinen Plastikbehälter montiert. Darin befindet sich das Saatgut. An der Unterseite des Containers ist eine kleine Drehscheibe, die ein bisschen aussieht wie ein Saugroboter. Sie gibt Stück für Stück die Samen ab, sobald Sachse die Schleuse am Einsatzort öffnet. Bis zu 20 Kilo Traglast kann die Drohne tragen und bei einer Runde ausspucken.
Dominik Wind steht jetzt ebenfalls auf der Forststraße und kontrolliert die Beladung der Drohne, er ist einer der Gründer von Skyseed, der Firma, die die Drohnensaat heute durchführt. Im Prinzip funktioniert sie ähnlich wie eine klassische Naturverjüngung, sagt Wind – der Samen wird abgeworfen, landet auf dem Boden und aus ihm heraus wächst ein neuer Baum. Wind: „Die Idee hatte ich bei einem Waldspaziergang. Ich habe mir damals gedacht, dass es eigentlich keinen großen Unterschied machen kann, ob ein Baumsamen jetzt aus einem Mutterbaum auf die Erde fällt oder aus einer Drohne, falls kein Mutterbaum mehr da ist.“
Er gründete sein Startup, sammelte Gelder und Investoren ein und begann mit ersten Versuchsreihen. Am Anfang ging einiges schief, sagt er: „Wir haben mit klassischen Samen gearbeitet, den fraßen dann aber Vögel, Mäuse oder auch Schnecken.“ Und wie es bei Naturverjüngungen manchmal so ist, gaben dann Hitze oder Kälte den Samen den Rest. Doch Wind und sein Team fanden eine Alternative: Sie pelletieren die Samen, das heißt, sie überziehen sie mit einer Schicht aus Ton, Pflanzenkohle und anderen biologischen Hilfsstoffen. Dadurch sind sie vor Fressfeinden und auch der Witterung geschützt. „Es darf nach nichts riechen und nach nichts schmecken“, sagt Wind, nur so bleibt das Saatgut als Futter unattraktiv. Bei dem patentierten Verfahren, das Skyseed anwendet, wird das Saatgut auf den jeweiligen Kunden angepasst, und das macht auch Sinn, weil ja jede Region anders ist und andere Anforderungen an die Bäume hat. Eine Zirbe, die im Zillertal wächst, unterscheidet sich doch von einer Zirbe aus dem Ausseerland. Dementsprechend haben die Bundesforste eines der größten Saatgutlager des Landes angelegt, in der so- genannten „Klenge“ im Waldviertel werden diese biologischen Schätze aufbewahrt und im Fall des Falles zur Wiederbewaldung bzw. zur Aufzucht von Forstpflanzen eingesetzt. Und das funktioniert auch hier: Für den Einsatz im Zillertal hatten die Bundesforste zunächst Samen an Skyseed geschickt, die diese dann aufbereitet haben.
Doch die Drohne wirft nicht nur aufbereitete Lärchen-, Kiefern-, Vogelbeeren- und Ahornsamen ab. In einer zweiten Runde werden auch 40 verschiede- ne krautige Pflanzen ausgesät: Spitzwegerich zum Beispiel, aber auch Schafgarben oder Kuckuckslichtnelken. Sie sollen dafür sorgen, dass eine stabile Krautschicht entsteht, die verhindert, dass der Boden erodiert oder gar austrocknet. Das schafft günstige Voraussetzungen für eine natürliche Verjüngung der Fläche – und sorgt auch dafür, dass die gesäten Bäume auch wirklich gut und schnell wachsen können.


Einstweilen ist das, was Wind und sein Drohnenpilot Sachse hier im Zillertal machen, nur ein Feldversuch. Bei den Österreichischen Bundesforsten, die pro Jahr Hunderte derartige Aufforstungen durchführen und heuer rund 1,4 Millionen Jungbäume gepflanzt haben, ist der fußballfeldgroße Fleck hier im Zillergrund eigentlich klein. Vernachlässigbar ist die Fläche trotzdem nicht, denn es handelt sich um Schutzwald „Tatsächlich“, sagt Revierleiter Tobias Robisch, „haben diese Aussaaten mit der Drohne großes Potenzial. Stellt sich auf derartigen Flächen erst einmal eine unerwünschte und konkurrenzstarke Begleitvegetation ein, zum Beispiel aus Himbeeren, Brennnesseln oder Adlerfarn, so haben es die Naturverjüngung oder aufgeforstete Pflanzen deutlich schwerer.“ Zeitnahes Entgegenwirken, so der Revierleiter, wäre also wichtig. Doch wie? Definitiv wird es in Zukunft deutlich mehr derartige kahle Flächen geben. Stürme und Orkane nehmen zu, die Schadholzflächen durch Windwürfe werden von Jahr zu Jahr mehr. „Wetterereignisse hat es immer gegeben“, sagt Hermann Schmiderer, Betriebsleiter der Bundesforste für das Unterinntal, „doch die Frequenz hat zugenommen. Es vergeht kein Jahr mehr ohne größeres Schadereignis.“ Ein „Schadereignis“ führt in der Regel zur Räumung einer Fläche, dieser Aufarbeitung folgt nach einer gewissen Zeit dann auch Aufforstung – und irgendwann kommt
man da mit den traditionellen Methoden im steilen
Gelände nicht mehr nach. Deshalb ist bei diesem ersten Drohnenversuch im Zillergrund auch Michael Lex vor Ort. Der 26-jährige ausgebildete Förster ist ebenfalls bei den Österreichischen Bundesforsten beschäftigt und arbeitet dort unter anderem als Innovationsbotschafter im Forstbetrieb Unterinntal. Auch Lex glaubt, dass der Einsatz von Drohnen in Zukunft nicht nur sinnvoll, sondern auch Standard werden könnte. Auch wenn es nicht ganz billig ist. Ein paar tausend Euro kostet so ein Drohneneinsatz mit der Skyseed Methode. Pro Tag. Gemessen am Schaden, der entsteht, wenn die Flächen kahl bleiben, ist das aber gut investiertes Geld. Und zwar nicht nur im Zillertal. Schwer erreichbare Hanglagen gibt es in Österreich nämlich genug.

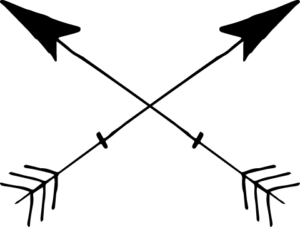
Moritz Gross
ist in Österreich lebender Deutscher. Die Forstwirte in
Mayrhofen haben ihm einen Auftrag mitgegeben: die
„Piefke-Saga“ zu schauen, die dort ganz in der Nähe
gedreht wurde.