Reportage
Wo seid ihr denn alle?
Erstmals wird es mehr alte als junge Menschen in Österreich geben. Eine Entwicklung, die sich nicht mehr nur in den Altersheimen abzeichnet, sondern auch auf der anderen Seite, bei den Jungen. Es gibt Gemeinden, da stehen sie ziemlich alleine da. Zum Beispiel in Semmering.

A
n die Ausfälle gewöhnte sie sich irgendwann, an das Gesicht der besten Freundin im Kästchen, oben am Bildschirm, völlig verpixelt. An die Stimme, die abreißt, das Stottern und daran, dass die Wortfetzen dann durchs Kinderzimmer hallen, wie kleine Hilferufe. Sie fand sich damit ab, dass es eben länger dauert, wenn sie sich gemeinsam vor dem Bildschirm schminken, dass die Outfits, die sie abstimmten, analog dann doch anders aussahen und dass sie das Duett von Billie Eilish eigent-lich alleine in ihren Zimmern singen. Annelie Wurm, 15 Jahre alt, kastanienbraune, spiegelglatte Haare und Augen so groß wie Murmeln, fand sich damit ab, dass sie ihre beste Freundin meist im Video-chat trifft, jede bei sich zu Hause, sie sagt: Es ist, wie es ist. Meistens jedenfalls.
Weil manchmal, selten zwar, aber manchmal reicht das kleine Kästchen oben am Bildschirm dann doch nicht mehr. Es sind Momente wie damals, als vor zwei Jahren ihr Uropa starb und zeitgleich die Oma der besten Freundin und sie vor dem Bildschirm sitzt wie amputiert, ohne Arm zum Umlegen, ohne Nase zum Anstupsen, ohne Brust zum Randrücken. Es sind Momen-te, in denen die Entfernung, die zwischen ihne-n liegt, die 25 Kilometer von Kinderzimmer zu Kinderzimmer, doch nicht kürzer wird, nur weil sich eine Verbindung aufbaut.
Annelie und ihre beste Freundin kennen sich seit vier Jahren, drei Monaten und zwölf Tagen, seit sie beide auf das Gymnasium Mürzzuschlag kamen und nebeneinander Platz nahmen. Und wenn man sie fragt, ob 25 Kilometer nicht zu weit sind für so eine Jugendfreundschaft, in der man spontan sein sollte und unbefangen, in der man gemeinsam auf den ersten Partys rumhängen sollte und nicht in Videochats, schaut sie einen fast mitleidig an. Gute Freunde, sagt Annelie, finde man schließlich nicht überall, schon gar nicht in ihrem Dorf.
Und nein, die Frage komme zwar oft, aber nein, es liege nicht an ihr oder daran, dass sie für die Jugendlichen in ihrer Nachbarschaft nichts übrighätte, bloß: Es gibt so gut wie keine.
Annelie Wurm wohnt in Semmering, dem Kurort am südlichen Rand von Niederösterreich. Außer ihr lebt hier nur noch ein anderer Fünfzehnjähriger. Insgesam-t gibt es zehn Teenager, von den 537 Ein-wohner:innen sind neun Prozent Kinder und Jugend-liche und über 30 Prozent Senior:innen, was so viel bedeutet wie: Die Gemeinde ist alt.
Österreich wird immer älter. Wir wissen, dass das Pensionssystem überlastet ist und die Altenpfleger:innen chronisch ausgebrannt sind. Wir wissen, dass wir immer länger leben und weniger Kinder bekommen. Wir wissen auch, dass sich die geburtenstarke Generation der sogenannten Babyboomer bald in die Pension verabschiedet. Die Sache ist nur: Bisher wurden die Pensionist:innen zwar immer mehr, die Jungen blieben dennoch in der Überzahl. Dass sich das gerade änder-t, wissen die wenigsten.
Philip Slepecki von der Statistik Austria sagt: „Wir befinden uns gerade an einem Kipppunkt, an dem die alte die junge Bevölkerung überholt.“ Wann genau dieser Punkt erreicht ist, ist schwer zu sagen und hängt auch von der genauen Definition von Alter ab. Fakt ist jedenfalls, dass wir uns gerade in einer Umbruchsituation befinden und – zumindest, was die Demografie angeht – in einer neuen Epoche. Neu ist auch, dass sich dieser Wandel nicht mehr bloß in Prognosen abzeichnet, sondern in Bars, auf leeren Sportplätzen, in überfüllten Pflegeheimen und in den Biografien von Tausenden Jugendlichen.


Im Sommer fährt Annelie die Downhillstrecke mit ihrem Mountainbike hinunter. Das Wichtigste sei, nicht zu viel zu denken, schon gar nicht ans Bremsen, sagt sie.
Ein Montagnachmittag im Mai, der erste warme Tag in diesem Jahr, ein paar schmutzweiße Wolken schieben sich über den Kurort, ansonsten ist der Himmel knallblau. Draußen vor der Tür liegt die Weltcuppiste wie ein schlafender, sattgrüner Riese. Drinnen sitzt Annelie am Esstisch und schaufelt sich Gnocchi Carbonara auf die Gabel. Gerade kam sie von der Schule, die dünne Nylonjacke hat sie noch an. Die Sonne scheint durch das Fenster auf die gerahmten Familienfotos: die Hochzeit der Eltern, Annelie als Baby, Annelie mit der Cousine. Darunter sitzt sie, Annelie, am Esstisch vor ihrem Teller und blättert durch ihr Hausübungsheft. Sie schaut auf die Uhr und schüttelt den Kopf, nein, sie möchte keinen Nachschlag, sie müsse doch bald schon wieder los.
Der Montag ist ein voller Tag, montags geht Annelie in den Klavierunterricht, sie hat Mathehausaufgaben und bleibt dann noch Zeit, dreht sie ein paar Runden mit dem Mountainbike. Annelie sagt das nicht gehetzt, die vollen Tage, das seien immerhin die guten. Wenn man viel zu tun hat, vergisst man schon mal, dass man allein ist.
Im Winter steht sie deshalb fast jeden Tag mit den Skiern auf der Piste, im Sommer stürzt sie sich die Downhillstrecke mit dem Mountainbike runter. An richtig heißen Tagen ist sie oben, am Schneekanonenteich mit ihrem Stand-Up-Paddle, das illegale Schwimmbad, wie hier jeder sagt. Manchmal ist die jüngere Cousine dabei, meistens ist sie allein, aber beim Sport, da merkt sie es gar nicht so richtig, beim Sport ist sie ja ohnehin für sich. Erst wenn sie wieder nach Hause kommt, sich im Kinderzimmer durch Instagram klickt, durch die Bilder von Influencerinnen, von diesen perfekt ausgeleuchteten Leben, den Freundesgruppen und Partys, erst da begreift sie wieder, dass das größte Highlight hier der McDonald’s im Nebenort ist.
Und dann ist da noch die Sache mit den Freundschaften und Beziehungen, die in die Brüche gehen, bloß weil man zu weit voneinander entfernt wohnt. So war das bei ihrem Kindheitsfreund, der zwei Häuser weiter wohnte und wegzog, und sie plötzlich niemanden mehr hatte, mit dem sie im Wald spielen konnte. Und so war das auch ein paar Jahre später, als sie von der Volksschule ins Gymnasium wechselte, von Schottwien nach Mürzzuschlag, und der Kontakt mit der besten Freundin plötzlich abriss. Seither schreiben sie sich nur noch an Geburtstagen.
Es gibt eine Studie, die besagt, dass Menschen rund 50 Stunden zusammen verbringen müssen, um Freunde zu werden. Die erste Requisite für das Drehbuch einer menschlichen Beziehung, so das äußerst ernüchternde Ergebnis, ist also die räumliche Nähe. Wer eines Tages zu unserem Freundeskreis zählen wird und wer nicht, hängt also zu großen Teilen von unserem Wohnort ab. Ob es nun Zufall oder das Schicksal war, das sie und die beste Freundin zusammenführte? Annelie schüttelt den Kopf, sie wisse es nicht, jedenfalls war es Glück. Großes Glück.
Sie geht jetzt zum Fenster, schaut raus durch die Scheibe, raus auf die sanften Hügel, sagt: „Es ist einfach alles so ausgestorben hier.“ Und wenn man die Dinge etwas zuspitzen müsste, dann ist es doch so. Was Erwachsene in den zwei Corona-Jahren als Jahrhundertkatastrophe wahrgenommen haben, als schmerzlichen Einschnitt in ihr Sozialleben, ist für Jugendliche wie Annelie Alltag: die Isolation, Einsamkeit, Freundschaften, die in die virtuelle Welt verlagert wurden, fehlende Umarmungen und verpasste Küsse. Manches kann man später woanders nachholen, anderes nicht. Die eigene Fünfzehnjährigkeit, die jedenfalls kommt nie zurück, so viel steht fest.
Und klar gibt es sie noch, die Kinder und Jugendlichen, sie verschwinden ja nicht einfach, nicht aus der Statistik und auch nicht aus dem echten Leben, aber in manchen Landstrichen gibt es nur noch so wenige, dass sie in den großen Klassenräumen richtig verloren wirken. Emanuel Richter, Politologe und Altersforscher, sagt: „Das Fatale an der Überalterung ist, dass sie sich eben nicht überall gleich stark bemerkbar macht.“ Regionen, die ohnehin von Abwanderung betroffen sind, stehen gleich doppelt unter Druck. Sie verlieren Einwohner:innen an die Ballungsräume, jene, die bleiben, bekommen weniger Kinder und die Alten werden immer älter. Das hat gravierende Folgen für die Infrastruktur, was wiederum den Wegzug der verbliebenen jungen Leute beschleunigt. Manche Gegenden in Österreich, ja in ganz Europa, kommen damit in eine Abwärtsspirale, heißt es in einer Untersuchung des Europaparlaments. Im Gegensatz zu Wien, Graz oder Innsbruck altern die ländlichen Regionen dagegen rasant, mancherorts sogar fünf Mal so schnell. Es gibt Gemeinden, da machen die unter 15-Jährigen nur noch knapp sechs Prozent der Gesamtbevölkerung aus, da kommen auf 200 Einwohner:innen nur noch eine Handvoll Kinder. Eine Entwicklung, die auf der demografischen Alterskarte recht gut abzulesen ist: Die Ballungsräume, dort, wo die Bevölkerung am jüngsten ist, leuchten im satten Grün, in der Mitte des Landes und an den Rändern zur Grenze hin, ganz besonders im Burgenland und im Waldviertel, franst sie aus, an manchen Flecken bleibt sie gar weiß. Und obwohl es jetzt immer heißt, dass der Klimawandel und Corona die Menschen wieder aufs Land treiben, hilft das den strukturschwachen Gemeinden nur wenig. Weil wer mag schon in eine Ortschaft ziehen, wo es nicht mal eine Schule gibt?
Das Problem mit der Überalterung, da ist sich Emanuel Richter, der Altersforscher, sicher, wird sich in Zukunft aber nicht mehr bloß auf Gemeinden und Dörfer beschränken, er sagt: „In der Provinz kann man schon jetzt auf kleinteiliger Ebene beobachten, was passiert, wenn einer Gesellschaft die Jungen langsam ausgehen.“

Die Volksschule am Semmering musste schließen, weil es zu wenig Kinder gab. Heute findet dort Klavierunterricht statt.
Annelie sitzt jetzt vor einem alten Irmbach-Flügel aus Vollholz, den Blick auf das Notenblatt gerichtet, die zarten Finger laufen über die Tasten. Neben ihr der Klavierlehrer, die Hände liegen ruhig in seinem Schoß, nur der Zeigefinger tippt im Takt von „Bohemian Rhapsody“. Hinter ihr an der Wand hängt die Tafel, an die jemand eine Sonne kritzelte, der Schaukasten mit den ausgestopften Tieren drin, daneben das Bild des ehemaligen Präsidenten Heinz Fischer. Zwei Jahre lang ging Annelie hier zur Volksschule, bevor diese dichtmachte, weil zu wenig Kinder nachkamen. Schwer vorzustellen, dass hier mal gelacht und gesungen wurde, an diesem Ort, der nach und nach zur Kulisse verkommt.
Nur einmal die Woche zieht hier noch Leben ein, wenn der Klavierlehrer kommt, die mobile Musikschule, wie er sagt. „Wenn wir nicht mehr zu den Kindern und Jugendlichen kommen, würde niemand in der Umgebung ein Instrument lernen.“ Es gibt Kolleg:innen, die seien jeden Tag 50 Kilometer unterwegs, pendeln von Schule zu Schule, weil es so wenige Schüler:innen gibt.
Manchmal fragt er sich, wie es mit den Jungen hier weitergeht, ob hier in 15 Jahren noch irgendjemand ein Instrument lernt, ob es dann überhaupt noch nennenswerten Nachwuchs gibt. Er sagt: „Ich schaue mir jedes Jahr die Geburtsraten der Region an und ja doch, ich bin besorgt.“ Nicht nur wegen seines Berufs, nein, man müsse sich doch nur umsehen, dort, wo der Nachwuchs fehlt, tun sich Lücken auf. Das ist es ja mit den Jungen, verschwinden sie aus den Gemeinden, verschwindet auch die Neugier, die Sorglosigkeit, da verschwindet irgendwann das Leben.
Man weiß ziemlich genau, was eine alternde Gesellschaft braucht: Mehr, viel mehr Pflegekräfte. Barrierefreie Wohnungen. Pensionsreformen. Es spricht ja auch das halbe Land über das Offensichtliche, nur über eine Sache wird geschwiegen, als wäre sie unsichtbar: die Bedürfnisse der Jugendlichen in einer Gesellschaft, in der sie langsam zur Minderheit werden.
Einmal saßen sie im Gemeindesaal, da stand Annelies Mutter plötzlich neben ihr auf und sagte: „Es muss doch was geben für die Jungen, irgendwas.“ Und die anderen im Gemeindesaal nickten, alle waren sich einig, dass die Jungen doch die Zukunft seien, dass man die wenigen, die noch da waren, halten müsse um jeden Preis – und es geschah: nichts. Ziemlich genau drei Jahre ist das her und noch immer gibt es keinen Treffpunkt für die Jugendlichen, keinen Sportplatz, kein Schwimmbad, keine Jungschar, nur der alte Pfarrer lässt sie ab und zu bei sich rauchen.
Der Semmering ist aber auch ein historischer Landstrich: Einst war er der Inbegriff von Prunk und Hedonismus, hier stiegen die Aristokraten ab, die Philosophen und Künstler des Fin de Siècle. Das mag an der Nähe zu Wien liegen, aber vor allem liegt es daran, dass es hier sehr, sehr schön ist: sanfte Hügel, große Wälder, weite Felder, wenige Menschen. Die Alpen, die sich hier nicht so brutal und schroff vor einem auftun wie im Tiroler Oberland, sie schmücken den Hintergrund, wie in einer etwas zu groß geratenen Miniatureisenbahnlandschaft. Und dann sind da noch die ehemaligen Prunkhotels, alle noch geschlossen, aber die große Hoffnung der Gemeinde. In vier Jahren, so der Bürgermeister Hermann Doppelreiter, könnte das erste wiedereröffnen. Und dann ziehe die Kultur wieder hier ein und dann würden auch die Arbeitsplätze kommen – und ja doch, auch die Jungen.
Vier Jahre, sagt Annelie, sie liegt jetzt auf ihrem Bett im Kinderzimmer und rechnet nach. In vier Jahren ist sie mit der Schule fertig, dann möchte sie ausziehen, ganz egal, wohin, Hauptsache, in eine WG. Gemeinsam mit der besten Freundin, versteht sich.
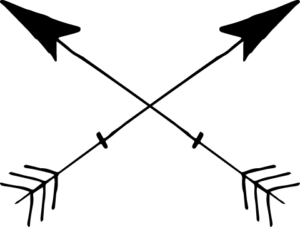
Lisa Edelbacher
fragt sich, wie die Jugendlichen von heute in ein paar Jahren auf die Zeit der Isolation und Einschränkungen zurückschauen werden. Und hofft, dass auf sie nicht vergessen wurde.