Reportage
Einmal zum Mitnehmen
Leben auf dem Land ohne Auto? Völlig undenkbar, sagen vor allem die, die dort leben. Andererseits: Wenn wir die Klimaziele schaffen wollen, dann muss es irgendwie anders gehen. Unterwegs in einer Region, in der es schon beinahe möglich ist.

Linke Seite: Der Blick über einen Teil des Defereggentals in Osttirol. Rechts: Peter Huber fährt ein Anrufsammeltaxi, das in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden ist.
A
n diesem Mittag im November teilt die Hauptstraße Abfaltersbach im Osttiroler Pustertal in kalt und warm. Die eine Seite des Tals wird von der Herbstsonne umhüllt, auf der anderen ist es schattig, auch temperaturtechnisch. Peter Huber hat seinen VW-Bus auf der kalten Seite geparkt. Warm angezogen ist er nicht, ein Hemd, dünner Pulli und eine halboffene Fleecejacke seiner Firma reichen ihm. Ist ja nur für eine Zigarettenlänge. Ein paar hundert Meter weiter befindet sich eine Holzfabrik, die Luft riecht, als hätte man die Nase in Zirbenöl gebadet. „Aufguss!“, ruft Peter. Er schaut auf die Uhr. Ein Zug noch, dann muss er los.
Peter ist einer von zwei Fahrern des 962T, ein sogenanntes Anrufsammeltaxi, das im Auftrag des Verkehrsverbund Tirol seit zwei Jahren über einen Subunternehmer unterwegs ist. Es funktioniert wie ein Linienbus, es gibt einen Fahrplan und fixe Stationen, alles ganz normal. Bloß: Es kommt nur, wenn es jemand rechtzeitig bestellt. In diesem Fall ist das eine Stunde vorher. In den kleineren Ortschaften geht es beim öffentlichen Verkehr nämlich vor allem um eines: Effizienz. Seine Linie führt von Abfaltersbach über Anras nach Thal. Das ist zwar nicht weit, circa 33 Kilometer, aber Peter sagt, jede Runde, die er nicht fährt, schont die Umwelt und natürlich die Geldtasche seines Arbeitgebers. Und warum sollte auch ein Bus fahren, wenn niemand drin sitzt außer dem Fahrer?
Die Idee hinter solchen Bussen hört auf den sperrigen Begriff „Bedarfsorientierte Mobilität“. Das heißt nichts anderes, als dass es die Angebote nur geben soll, wenn sie gebraucht werden. Manchmal zeitig in der Früh, manchmal mitten am Tag, immer, wenn es sonst keine Alternative zum Auto gibt, weil die Intervalle der anderen öffentlichen Verkehrsmittel zu weit auseinanderliegen oder weil die angefahrenen Haltestellen zu weit entfernt sind.

Nur kurz führt der Weg entlang der Hauptstraße, dann geht es hinauf, zuerst über die Pustertaler Höhenstraße, dann hinein durch schmale Bergdorfgassen, in denen ein großer 50-Sitzer niemals Platz hätte. Auf dem Weg nach oben kann man beobachten, wie die Häuser weniger werden, wie sie kaum noch zu sehen sind, weil sie hoch in den Hang gebaut wurden. Gegenden wie diese sind die große Herausforderung für die Planung öffentlichen Verkehrs, um das zu erkennen muss man kein Mobilitätsexperte sein. Weil ganz platt formuliert: Ein öffentliches Verkehrsmittel kann nicht jeden Fahrgast bis vor die Haustür fahren, macht es ja in Wien auch nicht, aber wenn es von einem Haus bis zum nächsten oft schon ein paar Kilometer sind, dann ist es bis zur nächsten Haltestelle manchmal so weit, dass in Wien schon eine ganze Straßenbahnlinie dazwischen Platz hätte.
Insgesamt 1.348.710 Menschen, mehr als umgerechnet 15,51 Prozent der Bevölkerung befinden sich, Stand 2017, laut der „Plattform Raumordnung & Verkehr“ ohne öffentliches Verkehrsangebot an ihrem Wohnstandort. Das heißt: So viele Menschen sind in Österreich nicht an das Öffi-Netz angebunden, weil eben die Haltestellen zu weit weg sind oder die Intervalle zu lange dauern (ein Angebot weniger als alle 210 Minuten). Auf dem Land ist es oft wirklich noch so, wie man sich das vorstellt: Da fährt der Postbus einmal in der Früh und dann wieder am Abend, wer mit seiner Erledigung, seiner Arbeit oder der Schule früher fertig ist, der sollte sich besser ein gutes Buch in den Rucksack packen. Den Betreibern kann man da keinen Vorwurf machen – es rechnet sich nämlich einfach nicht. „Alles, was seltener fährt als im Stundentakt, ist aber nicht akzeptabel, speziell für Personen, die alternative Verkehrsmittel zur Verfügung haben“, sagt Roman Klementschitz vom Institut für Verkehrswesen an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Er forscht seit über 20 Jahren zur Mobilität im ländlichen Raum, auch in Osttirol. Wenn es große zeitliche Löcher in den Fahrplänen gebe, sagt er, würde niemand mehr fahren. Und das sei natürlich fatal. Einerseits, weil sich die Menschen auch ohne Auto weiterbewegen können sollten, und weil, wenn Österreich seine Klimaziele erreichen will, wir vor allem die mit dem Auto gefahrenen Kilometer reduzieren müssen –
laut Studien von Umweltbundesamt und der Agora Verkehrswende um 25 bis 30 Prozent.

Weil Supermarkt-Mitarbeiterin Mathilde mit dem Anrufsammeltaxi zur Arbeit kommt, konnte sie ihr Auto aufgeben.
Z
urück in Unterried. Heute Vormittag hat Mathilde Kofler eine Fahrt bestellt, so wie jeden Dienstag, wenn sie nachmittags im ADEG des Ortes Dienst hat. Zu einer anderen Zeit würde ihre Haltestelle auch ein großer Bus anfahren, aber eben nur viermal am Tag. Und dazwischen? „Da kommt der Peter“, sagt sie. 2,60 Euro kostet sie eine Fahrt, egal, ob sie alleine ist oder andere Gäste mitfahren. Ihre Kinder, die in Innsbruck wohnen, hätten sich nie ein Auto gekauft, sagt Mathilde, der Umwelt wegen, und sie dachte sich: Da zieh ich mit. Hat sie es irgendwann mal vermisst? Nein, sagt sie, außer das eine Mal vielleicht, als sie der Peter im Schnee stehen hat lassen. „Mah, woaßt no wie vü Schnee des woar?“, fragt er.
An vielen Orten Europas beschäftigt man sich in großen grenzübergreifenden Förderprojekten mit der Aufgabe, öffentliche Mobilität auch in dünn besiedelten Gebieten zugänglich zu machen. Auch in Osttirol hat man in den vergangenen zehn Jahren viel Hirn und Arbeit hineingesteckt und an Projekten in der ganzen Region gearbeitet. Bei SMACKER, dem bislang letzten großen EU-Projekt, das mit einem Projektvolumen von 2,1 Millionen Euro in sechs Ländern arbeitete und dieses Frühjahr abgeschlossen wurde, lag zum Beispiel der Fokus auf Carsharing und CO2-freundlicher Urlaubsmobilität. Manfred Mair ist beim Regional Management Osttirol als Mobilitätsbeauftragter für dieses Thema zuständig, einem Verein, den alle Gemeinden und wichtigsten Institutionen der Region stützen. Bevor er das wurde, baute er in Osttirol das erste Carsharing mit Elektroautos auf, heute stehen sie an 13 verschiedenen Standorten in der ganzen Region. Mair hat sich ein Ziel gesetzt, dass, wenn man in die zersiedelten Täler schaut, beinahe unrealistisch wirkt: Er will eine Mobilitätsgarantie für ganz Osttirol. Was das heißen soll? „Ich möchte, dass Menschen ohne eigenes Auto das Gleiche erleben können wie Menschen mit Auto“, sagt er. Das gelte für Einheimische genauso wie für Gäste. Weil wer sagt, dass man unbedingt mit dem Auto in den Urlaub fahren muss?
Und tatsächlich hat die Region ziemlich aufgerüstet: Der neue Bahnhof in Lienz wurde schon als Mobilitätszentrum gebaut, es gibt Anrufsammeltaxis wie jenes von Peter, es gibt Elektro-Carsharing und die Öffis in Osttirol sind für alle Urlaubsgäste gratis. Damit diese Info auch ankommt, hat der Tourismusverband erst unlängst Mobilitätscoaches installiert, die die Hoteliers unterstützen sollen. Umfragen zeigen nämlich, viele Tourist:innen wären für einen autofreien Urlaub längst bereit.

Mobilitätsbeauftragte Manfred Mayr auf seinem E-Scooter in der Unterführung des neu gestalteten Lienzer Bahnhofs.
O
rtswechsel. Das Defereggental, 40 Kilometer westlich von Lien-z, ist eine Region, die das Label Abgelegenheit wirklich verdient. Es liegt mitten im Nationalpark Hohe Tauern, ist umschlossen von Berggruppen und gilt als eines der unberührtesten Hochgebirgstäler Österreichs. Wenn es darum geht, in völlig zersiedelten Gebieten mit Lösungen bis vor die Haustür zu kommen, steht man in den Gemeinden St. Veit, St. Jakob und Hopfgarten schon auf der Türmatte. Hier gibt es nicht nur ein Anrufsammeltaxi, sondern auch eine Lösung für die letzten Meter – und damit für wirklich alle 2.200 Bewohner:innen des Tals.
Im Gemeindeamt von Hopfgarten sitzt Erik Engel, knallrotes Kurzarmhemd, dicke Brille, vor ihm eine Minions-Tasse. Er ist nicht nur Bergbauer, sondern auch Projektleiter des e-defMobils 2.0, ein selbstverwaltetes, leistbares Gemeindetaxi. „Es ist ein Tür-zu-Tür-Service für alle, die es brauchen, die zum Friseur wollen, zum Supermarkt oder einfach zum Spazieren in der Sonne“, sagt Engel. Wie das funktioniert? Seit 2017 hat sich jede der drei Gemeinden im Tal ein E-Auto des Osttiroler Carsharing-Unternehmens „FLUGS“ gemietet, gefahren wird es von Freiwilligen, immer von Montag bis Freitag und zwischen 8 und 18 Uhr. Jeder Weg, egal, wie kurz oder lang, kostet pauschal einen Euro, den Rest der Kosten übernimmt die Gemeinde.
Heute ist Sepp im defMobil im Einsatz. Er ist 70 und war 40 Jahre Taxifahrer, der kleine Renault Zoe stellt ihn also vor keine großen Herausforderungen. Auch nicht, wenn es schneit. Heute war er mit Passagier:innen schon beim Friseur, beim Greißler, erst vor ein paar Minuten hat er Ingrid aus Lerch, einem Weiler ganz oben am Berg, zum Tanzkurs ins Kulturzentrum gefahren.
Projektleiter Engel hat jede einzelne Fahrt des e-defMobils aufgezeichnet, irgendwann hat er die Statistik erweitert, zwischen männlich und weiblich unterschieden (42 zu 58 Prozent) und sich angesehen, welche Altersschichten das Angebot am häufigsten annehmen (Frauen über 60 am häufigsten – 39% –, dann Männer über 60 mit 25%). Wie gut es ankommt, zeigt aber auch die einfachste Rechnung: Allein im August dieses Jahres war der Renault 565 Mal unterwegs.
„Wir haben viele kleine Angebote getestet“, sagt Manfred Mair vom Regional Management. Aber trotzdem: Was nach wie vor fehle, sei die Grundfinanzierung, also die Möglichkeit, Projekte überall umzusetzen, wo sie gebraucht werden. Außerdem glaubt er, dass es in Zukunft für jede Region einen – wie er es nennt – „Kümmerer“ geben müsse. Menschen wie Erik Engel oder ihn, die Projekte anschieben, sie nicht versickern lassen, wenn die Förderungen zu Ende sind. Und die natürlich auch neue Projekte an Land ziehen.

Die Tanzgruppe „Tanzen in der Lebensmitte“ trifft sich jeden Dienstag im Kulturhaus.
W
enn es um solche Projekte geht, kommt irgendwann der Punkt, an dem jemand fragt: Zahlt sich das für die paar Hanseln überhaupt aus? Und ist es etwas, für das die Allgemeinheit zahlen sollte? Schließlich haben sich viele ihren abgelegenen Wohnort ja selbst ausgesucht. „Gemeinden geben viel Geld für technische Infrastruktur, zum Beispiel für Lawinenverbauungen in alpinen Regionen, aus, selbst dann, wenn es nur um einzeln-e Häuser am Berg geht“, sagt Verkehrsexperte Roman Klementschitz von der BOKU, aber bei der Mobilität gebe es Scheuklappen. Dabei könnten ein paar tausend Euro Unterstützung im Jahr sehr viel voranbringen. Mindestbedürfnisse wie Arztbesuche oder Einkäuf-e würden ja noch im Familienverband gelöst werden können, bei anderen Wegen sei die Hemmschwelle deutlich größer. „Die wenigsten würden beispielsweise ihren Sohn bitten, sie ins Wirtshaus zu bringen“, sagt Klementschitz. „Umwegrentabilitäten“ nennt er es, wenn eine andere Möglichkeit geschaffen wird, dass das klappt. Die soziale Teilhabe würde nämlich dem ganzen Dorf helfen. So sieht das auch Mobilitätskoordinator Mair vom RMO. Er glaubt, dass die meisten gar nicht darüber nachdenken, wie sie ihr Leben ohne Autos schaffen können, weil es alternativlos scheint. Die Flexibilität wird in ländlichen Gebieten zwar nicht zu schlagen sein, aber im Hinblick auf den Klimawandel ist jeder Kilometer, der nicht gefahren wird, wertvoll.
Osttirol ist natürlich nicht die einzige Region in Österreich, in der an Lösungen gearbeitet wird – im Gegenteil. Die Website bedarfsverkehr.at hat alle Projekte aufgelistet, die sich damit beschäftigen – vom Burgenland bis in die letzten Ecken Vorarlbergs. Bereits 257 verschiedene Initiativen sind in 751 Gemeinden aktiv, das meiste tut sich im Süden, in der Steiermark und Kärnten. Allerdings: Laut der Website werden nur 0,2 Prozent der Wege mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegt.
Es ist später Nachmittag geworden, über das Defereggental stülpt sich die Dämmerung. Drinnen im Kulturhaus spielt die Musik, „Tanzen in der Lebensmitte“ heißt der Kurs, zu dem Ingrid aus Lerch und sechs andere Damen gekommen sind. Die meisten von ihnen nutzen das Gemeindemobil. Alle sind froh, dass sich das Projekt durchgesetzt hat: „Wenn Schnee liegt, fahr’ ich nicht mehr gerne selbst“, sagt Ingrid. „Ohne das Auto wär’ hier weniger los“, sagt Inge. „Sogar der Zusammenhalt im Ort ist größer geworden“, sagt Christl, die Tanzlehrerin.
Oben auf dem Berg steht Sepp neben dem Gemeindeauto. Gerade hat er zwei Wanderer nach Hause gebracht. Eine letzte Fahrt hat er noch, Ingrid muss nach dem Tanzen zurück auf den Berg. Warum er nach 40 Jahren Taxi freiwillig weiter fährt? „Als Taxler hab ich von den Leuten gelebt, jetzt mag ich was zurückgeben. So lange es geht.“
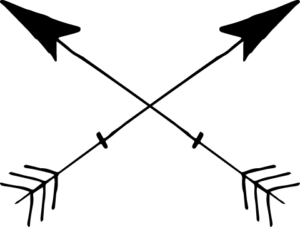
Christoph Wagner
ist immer wieder beeindruckt, wie furchtlos Menschen auf dem Land in enge Wege einbiegen. Umso mehr, wenn das Auto eigentlich kein kleines ist. Er ist deswegen froh, dass in Osttirol noch kein Schnee lag.