Natur & Mensch
Mut zur Hässlichkeit
Alles, was ein Baum schöner ist als ein Pfosten, das ist Luxus. Das gilt immer, nur nicht zur Weihnachtszeit. Denn da muss der Baum aussehen wie ein Top-Model. Warum? Und was ist das überhaupt, Schönheit?


Die kleine Gemeinde Metnitz in Kärnten ist international nicht besonders bekannt, wahrscheinlich haben auch die meisten Österreicher noch nie von ihr gehört. Einige Eingeweihte kennen die Metnitzer Schützen, die in den blauen Uniformen der Gardegrenadiere Napoleons und also ziemlich auffällig gekleidet sind, oder den Metnitzer Totentanz und die dazugehörigen Fresken am Karner, weil sie kulturhistorisch von Bedeutung sind. Und seit Anfang November kennen auch sehr viele Wiener Metnitz. Oder besser gesagt einen Metnitzer. 28 Meter ist er hoch, 150 Jahre alt, er musste mit einem Sattelschlepper in die Bundeshauptstadt gebracht und mit Kränen vorm Rathaus aufgestellt werden. Eine Fichte aus Metnitz ist der Wiener Christbaum in diesem Advent. Aber die Wiener sind unzufrieden. Regelrecht entsetzt. Hässlich, karg, viel zu wenig dicht, eine Schande, unzumutbar. So nannten sie den Baum, der, schön geschmückt, für festliche Stimmung sorgen sollte. Die Boulevardmedien griffen die Reaktionen auf, und es wurde auch nicht wesentlich friedlicher, als man den Baum künstlich um ein paar Äste ergänzt hat, so wie man manchmal die eigene Haarpracht mit ein paar Kunsthaarteilen üppiger erscheinen lässt. Gigantische 150 Jahre lang ist diese Fichte in Metnitz wirklich langsam und ungestört vor sich hingewachsen – und dann nimmt sie so ein Ende, verspottet als hässlicher, unförmiger Krampen.
Dabei ist hässlich eine Beschreibung, die uns bei Pflanzen sonst relativ selten in den Sinn kommt. Wir empfinden manche als schön, weil ihre Blätter speziell glänzen oder sie ganz besonders beeindruckende Blüten hervorbringen. Aber hässlich, unansehnlich, ekelerregend? Selbst wenn uns Pflanzen mit ihrer Schönheit nicht gerade umhauen, sie schrecken uns eigentlich niemals ab. Auch für die Pflanzen selbst ist das perfekte Aussehen eine ziemlich untergeordnete Kategorie. Wenn es um die Fortpflanzung geht, wird zwar schon auch mit optischen Tricks und Verführungselementen gearbeitet, allerdings werden damit nicht andere Pflanzen, sondern vor allem Tiere angelockt, die dann zum Beispiel den Samen verbreiten sollen. Dass die Wiener so empfindlich auf die Fichte aus Metnitz reagiert haben, liegt also nicht an ihrem durch die vielen Parks und ihre zurechtgestutzten Bäume und Büsche besonders ausgeprägten Ästhetizismus. Es liegt vor allem daran, dass dieser Baum nicht einfach nur ein Baum ist, sondern ein Christbaum. Christbäume sind unter den Bäumen so etwas wie Top-Models unter den Menschen. Sie müssen spezielle Maße haben, durch besondere Schönheit hervorstechen und zumindest so wirken, als wären sie perfekt. Und so wie die Top-Models verkörpern sie ein Schönheitsideal, das nur sehr wenige wirklich erreichen können. Christbäume werden nicht umsonst kultiviert, früh werden sie daraufhin geschult, wie sie auszusehen haben. Sie wachsen unter speziellen Bedingungen heran, alles, was stört, wird entfernt und die hässlichen werden vorsorglich aussortiert. Weil sie sowieso keiner kauft.
Wie ein Christbaum aussehen muss, weiß schließlich jedes Kind: Gerade gewachsen, perfekt symmetrisch und die Proportionen passen auch. Wenn Kinder einen Christbaum zeichnen, sieht er immer aus wie ein perfektes, ziemlich spitzwinkliges Dreieck. Fairerweise muss man sagen, dass das nicht die Schuld der Kinder ist: So wird ihnen das beigebracht und so kennen sie die Bäume aus ihren Bilderbüchern. Gibt es dort je schiefe Bäume? Lange, dünne? Kleine, dicke? Das Schönheitsideal für Bäume wird also schon in den Kinderbüchern geprägt, wie sollen die Wiener dann anders, als einen etwas ungewöhnlicher gewachsenen Baum gnadenlos mit Body-Shaming einzudecken?




Dabei kann man Bäume auch ganz anders betrachten. Der Förster, zum Beispiel, zieht einige weitere Kriterien in Betracht. „Die Größe ist wichtig, die Menge an nutzbarem Holz ebenso und auch, ob der Stamm gerade gewachsen ist, und die astfreie Länge zählt“, sagt Andreas Schweiger, Förster und Baumbegutachter bei den Österreichischen Bundesforsten. Wie ein Baum wächst, bestimmt sein Standort, der Boden, die Lichtverhältnisse und Witterungseinflüsse oder ob zum Beispiel Rehe an ihm geknabbert haben. Die Natur hält sich nun mal nicht an unsere Schönheitsideale. Sie macht, was sie schon immer macht und am besten kann – und passt sich an Klima- und Umwelteinflüsse an. So kann es sein, dass ein Baum in einem dichten Wald schief dem Licht entgegenwächst oder an einer exponierten Stelle im Lauf seines Lebens vom Wind geformt wird.
Der Blick des Försters ist sicher ein spezieller, doch auch Menschen, die den Baum an sich nicht nutzen, aber gerne im Wald sind, haben ein ziemlich eingeschränktes Bild von der schönen Natur. Immer noch irritiert es uns, wenn die Natur macht, was sie eben macht. „Wenn im Wald irgendwo Totholz liegen bleibt, weil das ein wichtiger Schutzraum und Nahrung für eine Unzahl an Tieren und Pflanzen und daher wichtig für die Artenvielfalt ist, empfinden das viele Menschen immer noch als unaufgeräumt“, beobachtet auch Andreas Schweiger. Sauber und geordnet sollte der Wald also sein, mit geraden Bäumen, die alle einfach so an ihrem Platz stehen. So hat sich das bei uns, auch durch einen jahrzehntelangen Fokus auf Monokulturwälder, wohl eingebrannt. Dass ein etwas außergewöhnlich gewachsener Christbaum irritiert, ist also nicht
sehr überraschend.
Wien ist allerdings nicht der erste Ort, der damit seine Erfahrung macht. 2016 ist die kanadische Stadt Montreal ein bisschen plakativ in den Wettbewerb um den schönsten, tollsten Christbaum eingestiegen. Sie hat angekündigt, ihr Christbaum würde höher sein als jener vor dem Rockefeller Center in New York City. Die Tanne, die dann in Montreal aufgestellt wurde, blieb dann aber höhenmäßig hinter jener New Yorks zurück – und war noch dazu ein bisschen schief. Es hagelte Häme und Spott. Im Jahr darauf hat Montreal sich gedacht, dass es auch anders gehen muss. Ganz bewusst wurde ein Baum aufgestellt, der mit dem herkömmlichen Schönheitsideal von Christbäumen überhaupt nichts am Hut hatte, dafür aber wie ein Hut aussah: Wie ein Hexenhut nämlich, weil sein Wipfel einfach so nach unten hing und die unteren Lagen von Ästen ziemlich bauchig waren. Als ein Zeichen für Vielfalt und zur Wertschätzung des Unperfekten wurde er gefeiert. Wunderschön geschmückt stand er auf dem Weihnachtsmarkt, wo dann passenderweise auch Obst verkauft wurde, das ebenfalls nicht ganz so perfekt war. Das ein paar Druckstellen hatte, ein bisschen länglicher oder dicklicher war, als wir es normalerweise aus dem Supermarkt kennen. Oder aus den Kinderbüchern. Und 2018 wird es in Montreal ganz genauso wieder gemacht: Der Baum ist ein Baum, der sein darf, wie er eben ist. Das ist wunderschön. Vielleicht werden das auch die Wiener noch bemerken. Die Chance dazu haben sie jetzt jedenfalls.
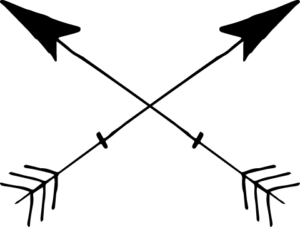
Martina Bachler
hat sich auch schon bei ihren Eltern darüber beschwert, dass der Christbaum zu kahl, karg oder schief ist. Dieses Weihnachten gilt aber: Der Baum wird akzeptiert, wie er ist. Vorausgesetzt, es hängt genug Lametta drauf.